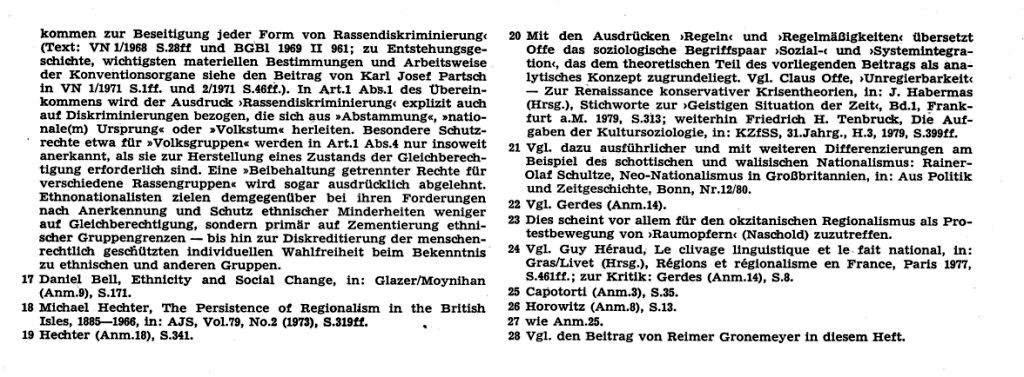In: Vereinte Nationen, Zeitschrift für die Vereinten Nationen, ihre Sonderkörperschaften und Sonderorganisationen. Heft 4/1980
Vgl. auch: https://www.jstor.org/stable/40775783?seq=1#page_scan_tab_contents
Dirk Gerdes:
Minderheitenschutz - Eine internationale Rechtsnorm auf der Suche nach ihrem Gegenstand
In: Vereinte Nationen 4/80, 126-131
Einleitung
Weder die Charta der Vereinten Nationen noch die am 10. Dezember 1948 verkündete Allgemeine Erklärung der Menschenrechte hatten nach dem durch den Zweiten Weltkrieg verursachten Kontinuitätsbruch die Fortsetzung oder Übernahme des Minderheitenschutzsystems des Völkerbundes aus der Vorkriegszeit angedeutet. Vorschläge, in die Menschenrechtserklärung eine Passage über Minderheitenrechte einzufügen, wurden nicht aufgenommen1). Fast zwei Jahrzehnte blieb dann die Diskussion über einen internationalen Minderheitenschutz im wesentlichen auf die 1946 als Nebenorgan des Wirtschafts- und Sozialrats gegründete Menschenrechtskommission und deren 1947 eingerichtete „Unterkommission zur Verhütung von Diskriminierung und für Minderheitenschutz“ beschränkt - bis es am 16. Dezember 1966 zur Verabschiedung der beiden Menschenrechtspakte durch die Generalversammlung kam. Der Pakt über bürgerliche und politische Rechte definiert in seinem Artikel 272) die Rechte der Angehörigen von Minderheiten. Schon in den vorbereitenden Diskussionen, verstärkt aber bei den sich zur Verwirklichung dieses Artikels anschließenden Überlegungen zeigte sich die Problematik der juristischen Kodifizierung eines hochkomplexen gesellschaftlichen und politischen Phänomens; eine Problematik, die durch den universalen Anspruch dieser neuen Völkerrechtsnorm noch verschärft wird. Es dauerte weitere elf Jahre, ehe der italienische Völkerrechtler Francesco Capotorti (namens der Unterkommission) der Menschenrechtskommission eine erste offiziöse Interpretation dieses Artikels vorlegen konnte; die Erstellung der Studie hatte immerhin noch sechs Jahre beansprucht. In ihrem Vorwort3) betont er ausdrücklich, dass seine Arbeit aufgrund ihres rein juristischen Charakters nur Anstöße für eine Intensivierung der weiteren Diskussion geben kann - dies vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Minderheitenschutz einerseits als politische und völkerrechtliche Norm zunehmend Anerkennung findet, andererseits bisher nur wenige Staaten sich davon betroffen geben, indem sie für sich die Existenz von Minderheiten anerkennen. Dies trifft zusammen mit einem scheinbar weltweiten Trend der Intensivierung ethnischer Konflikte4), der auch von Sozial- und Kulturwissenschaftlern zunehmend mit der Minderheiten-Begrifflichkeit analysiert wird.
Die folgende kurze Problemskizze greift aus sozialwissenschaftlicher Sicht einige bei Capotorti primär juristisch abgehandelte Konfliktfelder und Interpretationsschwierigkeiten des Art. 27 auf, deren Analyse den relativ geringen praktischen Schutzwert dieses Artikels deutlich machen und zugleich punktuelle Hinweise auf außerhalb juristischer Zirkel diskutierte Theoreme über ethnische Konfliktartikulation geben soll.
Im Wesentlichen lassen sich die Auseinandersetzungen über die juristische Kodifizierung eines internationalen Minderheitenschutzes am Beispiel des Art. 27 in drei Punkten ordnen:
1. Der Pakt von 1966 unterscheidet drei Kategorien von Minderheiten: ethnische, religiöse und sprachliche. Abgesehen von der Schwierigkeit einer begrifflichen Unterscheidung dieser drei Typen ergibt sich hier vor allem das Problem ihrer realsoziologischen Identifizierung: Was sind ethnische/religiöse/sprachliche Minderheiten etwa in Abgrenzung zu isolierten Überresten traditionaler Gruppenstrukturen (z. B. Clans, Stämmen) einerseits und modernen gesellschaftlichen Formationen (z. B. Sozialbewegungen und Interessengruppen) andererseits?
2. Minderheitenschutz definiert sich im Kontext des Art. 27 als Bestandteil universal gültiger Menschenrechte. Der Universalitätsanspruch verbietet eine eng spezifizierte Definition der realen und potentiellen Objekte (!) dieses Schutzartikels. Außer den genannten Identifizierungs- und Abgrenzungsschwierigkeiten taucht hier zusätzlich noch die Frage auf, ob die mit der Bezeichnung „Minderheit“ suggerierte Vergleichbarkeit unterschiedlichster Minoritätenprobleme einer analytischen Betrachtungsweise standhält.
3. Rechtsträger des Minderheitenschutzes nach Art. 27 sind nicht Gruppen, sondern Individuen in ihrer Eigenschaft als Angehörige dieser Gruppen. Gleichwohl setzen die zu schützenden Rechte die Lebensfähigkeit der entsprechenden Referenzgruppen voraus. Bei der Spannweite der vom Minderheitenbegriff erfassten Gruppenstrukturen sind Extremfälle denkbar, in denen einerseits Individuen vor ihren Referenzgruppen zu „schützen“ sind, andererseits sich der Minderheitenbegriff angesichts einer flexibel gehandhabten individuellen Identifikation mit unterschiedlichen Referenzgruppen verflüchtigt. Neben den genannten Abgrenzungs- und Vergleichbarkeitsschwierigkeiten entstehen hier zusätzliche Anwendbarkeitsprobleme, für die ein juristisch kodifizierter Minderheitenschutz ein zu statisches Korsett bildet. Obwohl die genannten drei Problembereiche in enger Wechselbeziehung stehen, werden sie im Folgenden nacheinander abgehandelt.
Problembereich 1: Unbestimmtheit des Minderheiten-Begriffs
Auch Capotorti muss feststellen, dass sich die Anwendung von Art. 27 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte nicht auf eine allgemein anerkannte Begriffsdefinition stützen kann. Gleichwohl erklärt er, dass die „Hauptelemente des Konzepts ‚Minderheit’ gut bekannt“ seien. Ein unbestreitbarer Kernbestand seien die „objektiven“ und „subjektiven Kriterien“, wie sie in seinem Definitionsversuch5) festgehalten werden. Abgestellt wird hier auf eine numerisch unterlegene und nicht-dominante Gruppe in einem Staat, deren Angehörige ethnische, religiöse oder sprachliche Merkmale besitzen, die sie von den übrigen Staatsangehörigen unterscheiden, und bei denen ein auf die Bewahrung dieser Eigenheiten gerichtetes Solidaritätsgefühl wenigstens implizit vorhanden ist. Der nächstliegende Einwand gegenüber dieser Definition richtet sich gegen die Trennung von subjektiven und objektiven Kriterien. Hier gilt ebenso wie bei vergleichbaren Definitionen von „Nation“ und „Nationalität“ Hans Mommsens Hinweis, dass sich „angeblich objektive, von den Individuen unabhängige Kriterien nationaler Zusammengehörigkeit ... bei genauerer Analyse in historisch vermittelte Bewusstseinsinhalte auf(lösen)“6).
Schutz wird nach Wortlaut und Interpretation der hier exemplarisch diskutierten Minderheiten-Definition nur Gruppen innerhalb staatlich organisierter Kollektive zuteil. Ausgeschlossen sind also „weiße Flecken“ auf der Landkarte, die Gebiete bezeichnen, für die staatliche Organisation formal postuliert, aber nicht effektiv ausgeübt wird. Hier eventuell lebende, von der Umwelt völlig abgeschlossene Gruppen werden erst dann zu Minderheiten, wenn sie beispielsweise durch Besiedlung, Straßenbau und Handel in Berührung mit einer übermächtigen Gesellschaftsorganisation geraten. Minderheitenschutz sollten demnach beispielsweise eine ständig zunehmende Anzahl eingeborener Gruppierungen der tropischen Regenwälder in Brasilien (das bezeichnenderweise nicht zu den Vertragsstaaten der Menschenrechtspakte zählt) genießen - es sei denn, sie würden als zu „unbedeutend“ angesehen, als dass man dem Staat ihren Schutz „zumuten“ könnte7).
Hier fließt selbst bei einem Minderheitentyp, für den noch am ehesten eine „objektive“ (ethnosoziologische) Beschreibung der ihn prägenden kulturellen bzw. ethnischen Charakteristika möglich ist, ein subjektives Urteilsmoment ein: entscheidend für die Wirksamkeit des Schutzgedankens kann bei vorindustriell-traditionalen Gruppierungen sein, ob man die Gruppengrenzen enger oder weiter zieht, ob man also etwa personenverbandliche (Sippe, Clan) oder abstraktere kulturelle bzw. religiöse (Animismus) Charakteristika als ausgrenzende Kriterien bestimmt.
Noch deutlicher wird die historische Relativität und Vermitteltheit scheinbar objektiver Kriterien, wenn man - immer noch im Bereich vorindustriell-traditionaler Gruppierungen - die fließenden Grenzen ethnischer Gruppenbildung beispielsweise in Afrika analysiert. Donald L. Horowitz, Experte für ethnische Probleme der Dritten Welt, gibt hierfür zahlreiche Belege und fasst die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen wie folgt zusammen:
„Als Geschöpfe ihrer Geschichte und Traditionen wurden ethnische Gruppen lange Zeit als weitgehend unveränderliche, ja sogar als ursprüngliche (primordial) Kräfte angesehen. Heute vertreten die meisten Forscher ethnischer Beziehungen nicht mehr die Lehrmeinung von der so genannten ‚eindeutig objektiven Realität’ ethnischer Gruppen und ethnischen Konflikts. Die langsam sich durchsetzende Sichtweise betont das Fließende und die Variabilität ethnischer Identitäten und Beziehungen.“8)
Eine rechtsdogmatisch-kodifizierende Einschätzung von Minderheitenproblemen versperrt dagegen den Blick auf die dynamischen, kontextabhängigen Faktoren ethnischer, religiöser oder sprachlicher Konfliktartikulation. Man muss dabei keineswegs so konsequent „materialistisch“ argumentieren wie Orlando Patterson, der kategorisch feststellt: „Ethnische Loyalitäten spiegeln die zugrunde liegenden sozioökonomischen Interessen von Gruppenmitgliedern wider und werden von diesen aufrechterhalten“9), um auf die Grenzen einer juristisch starren Minderheitenschutzpolitik aufmerksam zu werden. Die jugoslawische Regierung betonte in ihrem Kommentar zur vorläufigen Definition Capotortis10) jedoch zu Recht die „politische Atmosphäre und die kulturellen und sozialen Umstände"11) als Kontextfaktoren ethnischer Konfliktartikulation. Minderheitenschutz setzt zwar an diesem Kontext an, tendiert aber in kodifizierter Form zur Verselbständigung, die schließlich in einen aufwendigen Schutz leer laufender, weil kontextabgehobener folkloristischer Rituale einmünden kann - eine Gefahr, die durch die Verpflichtung des Staates auf aktive Förderung12) seiner Minderheiten in eine missbräuchliche Anspruchshaltung von Seiten scheinbarer Minderheiten oder in die Verschleierung „echter“ Minderheitenprobleme von Seiten des Staates umschlagen kann. So ist es für den Schutz einer Minderheit oft wichtiger, eine gezielte Schnapsversorgung und deren repressive Ausnutzung zu unterbinden, als um den Freiraum für kulturelle Verrichtungen besorgt zu sein.
Je stärker nun die Kontaktflächen zwischen vorher relativ isoliert in „geschlossenen Horizonten“13) sich reproduzierenden Mehrheits- und Minderheitsgruppierungen ausgeprägt sind, je intensiver die Osmose zwischen unterschiedlichen Lebensweisen und Verkehrsformen zu deren Angleichung - wenn auch zunächst nur in Teilbereichen - führt, desto unzureichender, umstrittener oder sogar fragwürdiger wird ein Minderheitenschutz in dem durch Art. 27 umschriebenen Rahmen. Analysiert man aber sozusagen am anderen Extrempunkt eines Kontinuums die ethnisch artikulierten Konflikte in westlichen Industriegesellschaften, dann erscheint ein Minderheitenschutzkonzept ohne sorgfältige Kontextbestimmung bestenfalls als nostalgische, wenn nicht als ethnonationalistische Blickverengung14). Soweit ethnische Probleme nicht durch den Anti-Diskriminierungsartikel des Pakts über bürgerliche und politische Rechte15) abgedeckt werden - ähnliches gilt auch für den Rassismus-Komplex16) -, sondern aus einem von randständigen Bevölkerungsteilen artikulierten „besonderen“ Existenz- und Förderungsanspruch resultieren, dürfte nur noch wenigen ethnischen, religiösen oder sprachlichen Gruppierungen mit einer Garantie auf freie Entfaltung ihrer Kultur, Traditionen, Religion oder Sprache ausreichend gedient sein.
Es ist unbestritten, dass sich auch in den „modernen“ Industriegesellschaften des Westens - trotz jahrhundertelanger Verwirbelung bodenständiger lokaler und regionaler Lebensweisen mit aus der Industrialisierung resultierenden bzw. sie begleitenden funktionalen Verhaltensnormen - „eigen-sinnige“ Besonderheiten in Lebensweise, Einstellungen oder Sprache erhalten konnten. Diese Charakteristika entfalteten jedoch lange Zeit keine soziale und politische Wirksamkeit in der Form, dass ihre „Provinzialität“ sich zu einem kollektiven „ethnischen“ Minderheitenproblem auskristallisierte. Gleichwohl wird heute die teleologische Perspektive strukturfunktionaler Modernisierungstheorien kritisiert, die generell einen Modernisierungstrend hin zu einer funktional arbeitsteiligen Leistungsgesellschaft unter Abbau traditionaler „Restbestände“ ethnischer Vergesellschaftung annahmen. Entgegen den Prognosen dieser Theorien sind ethnische Identitäten „provinzieller“ Prägung heute wieder verstärkt „zur strategischen Wahl von Individuen (geworden), die unter anderen Umständen andere Gruppenzugehörigkeiten wählen würden“17). Über das Moment der Wahlfreiheit wird noch zu sprechen sein. Festzuhalten ist zunächst, dass gesellschaftliche, politische und kulturelle Kontextbedingungen die moderne Variante ethnischer Konfliktartikulation ungleich stärker bestimmen als deren weiter oben skizzierte traditionale Variante - dies bis hin zu einem Punkt, in dem sich Minderheitenschutz an seinem Objekt verflüssigt, weil die Grenzen zwischen Minderheiten- und „normaler“ Interessengruppenpolitik fließend werden.
Die hier nur angedeutete Spannweite für den Geltungsbereich der zitierten Minderheitendefinition wirft das Problem auf, ob es sinnvoll ist, alle in Frage kommenden Minderheitenphänomene unter einer einzigen Schutzklausel zusammenzufassen. Voraussetzung einer solchen Zusammenfassung wäre eine Vergleichbarkeit dieser Phänomene, die nicht rechtsdogmatisch postuliert, sondern sozialwissenschaftlich plausibel begründet werden müsste. Hierfür ist bei aller gebotenen Kürze zunächst ein analytischer Rahmen zu erörtern.
Problembereich 2: Vergleichbarkeit von Minderheiten
Michael Hechter, einer der schärfsten Kritiker strukturfunktionaler Modernisierungstheorien, kann für einen solchen Vergleich einen ersten theoretischen Hinweis geben. Er unterscheidet bei der Beschreibung der Binnendifferenzierung einer (staatlich) organisierten Gesellschaft zwei Typen: einen „funktionalen Sektionalismus“ als Folge einer Gruppenbildung nach Kriterien einer arbeitsteiligen Leistungsgesellschaft „modernen“ Typs und einen „peripheren Sektionalismus“, der für Modernisierungstheoretiker lediglich Restbestände und ökologische Nischen markiert, in denen sich „vormoderne“, askriptive, also vor allem kulturelle Identitäten als Fixpunkte von Gruppenbildung gehalten haben18). Gegen die These von der allmählichen Verdrängung peripherer durch funktionale Gruppenzugehörigkeiten wendet er ein, dass sich das Diffusionsmodell der Modernisierungstheorien als unzulänglich erweise, „da es nicht die Nützlichkeit einer Beibehaltung peripherer kultureller Identität als eine Form politischer Mobilisierung bei Gruppen erwägt, die sich als benachteiligt ansehen“19). Es ist hier nicht der Ort, die von Hechter analysierte spezifische Art von Benachteiligung - den „internen Kolonialismus“ - näher zu untersuchen. Wichtig ist hier nur die Verbindungslinie, die von Hechter generell zwischen „Benachteiligung“ und Minderheitenprotest gezogen wird; die Betonung also der expressiven und instrumentellen Funktion, die einer ethnisch, religiös oder sprachpolitisch artikulierten Konfliktformation zukommt: Die übereinstimmenden Grenzlinien von kultureller Andersartigkeit und ökonomisch-struktureller Benachteiligung ermöglichen erst eine „ethnische“ bzw. nationalistische Mobilisierung gegen strukturelle Über- und Unterordnungsverhältnisse. Kulturelle Andersartigkeit und daraus folgende kulturelle Unterdrückung reichen allein nur selten aus, um einen Konflikt zwischen Mehrheit und Minderheit über lange Perioden hinweg aufrechtzuerhalten.
Modernisierungstheorien - so lässt sich dieser Faden weiterspinnen - neigen dazu, die strukturellen Differenzierungsprozesse in immer spezialisiertere, arbeitsteilige Agenturen und Institutionen (Subsysteme) der Gesellschaft mit einer synchron ablaufenden Differenzierung auch der kulturellen Handlungsorientierungen, Werthaltungen und Normen gleichzusetzen. In traditionalen Lebenszusammenhängen bezeichnet Kultur noch eine sinnhafte und zugleich normative „Gesamtschau“ konkreter gesellschaftlicher Beziehungsstrukturen; überspitzt formuliert, ist Kultur hier (weitgehend) identisch mit Struktur, sind „Regeln“ zugleich auch unmittelbarer Ausdruck von „Regelmäßigkeiten“20). Dieser vergleichsweise unproblematische und konkrete Zusammenhang geht allerdings mit zunehmender innergesellschaftlicher Differenzierung dadurch verloren, dass sich die „Regelmäßigkeiten“ abstrahieren und heute in normengeleitetem, „sinnvollem“ Handeln nur noch insofern aufzuspüren sind, als sich „Kultur“ in die magere „Gesamtschau“ kultureller Surrogate wie dem Bild von der „Leistungsgesellschaft“ und den mit einer generalisierten Wachstumsorientierung einhergehenden Normen verflüchtigt. Gesamtgesellschaftlich wirksame Kultursurrogate wie nationalistische und imperialistische „Ziviltheologien“ (Daniel Bell) kann man schließlich als Versuch verstehen, der fortschreitenden Binnendifferenzierung den Schein traditionaler Geschlossenheit zu vermitteln, aus „Gesellschaft“ zunächst intellektuell, dann ideologisch und politisch-normativ „Gemeinschaft“ hervorzuzaubern.
Modernisierungstheorien nehmen diese Form kultureller Sozialintegration nicht zur Kenntnis und unterschätzen gleichzeitig die Beharrlichkeit, mit der sich provinzialisierte kulturelle Teilidentitäten gegen eine funktionale Auflösung behaupten. Dabei ist es eine der wichtigsten Leistungen gerade nationalistischer und imperialistischer Ziviltheologien, durch Projektion solcher Teilidentitäten auf größere Zusammenhänge diese als eigenständige Faktoren gesellschaftlicher und politischer Relevanz überhaupt erst neutralisiert zu haben. Genau an diesem Punkt des Argumentationsganges hat nun eine sozialwissenschaftlich fundierte Analyse des Minderheitenproblems anzusetzen. Vor dem Hintergrund des skizzierten analytischen Rahmens Iässt sich dann thesenartig die folgende Differenzierung ethnischer (religiöser/sprachlicher) Minderheitenphänomene vornehmen:
1. Für traditionale Gesellschaftssegmente Iässt sich mit vergleichsweise größter Eindeutigkeit eine enge Korrespondenz kultureller Handlungsorientierungen mit strukturellen Funktionsmustern feststellen. Die Bedrohung der kulturellen Eigenart solcher Minderheiten ist zugleich auch eine Bedrohung ihrer Lebensform. Kultureller Minderheitenschutz zielt hier auf den Kernbestand der Existenz sowohl der Gruppe insgesamt als auch der jedes ihrer Mitglieder.
2. Eine a) entweder gewaltsam vorangetriebene oder b) im historischen Ablauf sich allmählich „von selbst“ einstellende Angleichung der strukturellen Funktionsmuster von Mehrheit und Minderheit führt nicht automatisch auch zu einer Angleichung der kulturellen Handlungsorientierungen. Im Falle a) ist es wahrscheinlich, dass diese Handlungsorientierungen sich als Potential ethnischen Widerstands gegen die Herrschaft durch die Mehrheit zumindest latent konservieren, auch wenn sie zeitweise in Ziviltheologien übergeordneter Einheiten aufgehen oder oberflächlich überlagert erscheinen durch „moderne“ Verhaltensweisen, die diesen übergeordneten Einheiten zugeschrieben werden. Im Falle b) sinken die peripheren Kulturmuster zu provinzialisierten Ritualen ab und verlieren weitgehend ihre praktisch-konkrete Orientierungsfunktion.
3. Ist im Falle 2a) die strukturelle Angleichung insofern unvollständig, als eine weiterwirkende Grenzlinie zwischen Mehrheit und Minderheit erkennbar bleibt (Hechter: „kulturelle Arbeitsteilung“), dann führt ein Zusammenbruch bzw. eine Erosion der integrierenden Ziviltheologie (einschließlich ihrer eventuellen Nutzeffekte) mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Aktualisierung latenter peripherer Identitäten21).
4. Ist im Falle 2b) die strukturelle Angleichung weitgehend vollzogen, so bedeutet dies nicht, dass die ritualisierten und provinzialisierten Kulturmuster mit ihrer praktisch-konkreten Orientierungsfunktion zugleich auch ihre ideologische oder politische Sprengkraft verlieren. Ökonomische Konzentrationsprozesse („ungleiche Entwicklung“) können auch vor dem Hintergrund relativ angeglichener Gesellschaftsstrukturen die territoriale Komponente gesellschaftlicher Ungleichheit revitalisieren - dies unter anderem dann, wenn andere gesellschaftliche Konfliktformationen (Klassenkonflikte oder sektorale Konflikte) ihre Virulenz einbüßen22). Eine Revitalisierung territorialer Strukturunterschiede auf neuer Basis kann intellektuelle Rekonstruktionsversuche der provinziell versickerten Identität ermuntern, deren Mobilisierungswirksamkeit jedoch fast ausschließlich von materieller Betroffenheit abhängt23). Ein Minderheitenschutz, der sich an Regionalismen dieser Genese anhängt, ist verschleierte Interessengruppenpolitik.
5. Unabhängig von der strukturellen Ausprägung gesellschaftlicher Ungleichheit - sei es historisch verstetigter oder neu sich bildender - können provinzialisierte Restbestände kultureller Sondertraditionen auch ein Reservoir für intellektuell-normative Alternativen zu den Kultursurrogaten der Leistungsgesellschaft und der Konsumorientierung abgeben. Die Wiederbelebung nahezu verschütteter kultureller Traditionen kann dann zu einer subkulturellen Rekonstruktion auch der entsprechenden Lebensformen eingesetzt werden, die sich allerdings nicht mehr auf eine wenn auch noch so verborgene Persistenz traditioneller ethnischer Lebensformen berufen kann, sondern diese neu erfindet. An dieser Form von Minderheitenpolitik gleitet Minderheitenschutz ab oder führt sich ad absurdum (Minderheitenschutz etwa für die „Freie Republik Wendland“?).
6. Einen Sonderfall bilden Ereignisminderheiten, Gruppen also, die als Folge von meistens kriegsbedingten Grenzveränderungen sozusagen über Nacht ihre Staatsangehörigkeit wechseln. Der plötzliche Verlust einer selbstverständlichen strukturellen wie kulturellen Einbindung führt hier - meistens verstärkt durch gezielte Diskriminierung und gewaltsame Assimilation - in der Regel zu einer virulenten Selbstabschließung als Minderheit.
Dem Schutz dieser letztgenannten nationalen Minderheiten war das völkerbundliche Minderheitenschutzsystem der Zwischenkriegszeit verpflichtet. Trotz seiner spezifischen Kontextbedingungen gilt es aber auch heutigen Verfechtern eines internationalen Minderheitenschutzes als Modellfall, aus dem der Schutzanspruch auch für Minderheiten der unter den Punkten 1 bis 5 skizzierten Kontextbedingungen abgeleitet wird. Dieser besonderen Tradition heutiger Minderheitenpolitik ist es zugleich zuzuschreiben, dass eine der zentralen Auseinandersetzungen sich an der Frage entzündet hat, wer Rechtsträger eines Minderheitenschutzes sein soll: Individuen als Angehörige einer Minderheit oder die Minderheit als Gruppe?
Problembereich 3: Minderheitenschutz - Schutz für Individuen?
Sowohl die völkerbundlichen Schutzverträge als auch der Art. 27 des Paktes von 1966 haben Minderheitenschutz als Schutz von Individualrechten, nicht aber als Garantie von Gruppenrechten definiert. Dieses aus menschenrechtlichem Denken abgeleitete Schutzprinzip stand von Anfang an in Konkurrenz zu einer Denkrichtung, die Minderheitenschutz primär als Schutz eines gesellschaftlichen „Organismus“ interpretierte: Minderheiten sind in dieser Sichtweise „Gemeinschaften“, in die ein Individuum nur als auswechselbarer Träger gemeinschaftlicher Attribute (Guy Héraud: „Ethnotyp“) hineingeboren wird, die also eine von Individuen unabhängige Existenz haben (Héraud: „fait national“). Es ist unverkennbar, dass diese ethnonationalistische Denkrichtung ihre Kategorien aus der Analyse vor allem jener traditionalen Gruppierungen ableitet, die oben als erste Variante ethnischer Gruppenbildung dargestellt wurde. Bezeichnend hierfür ist, dass ethnonationalistische Theoretiker, wenn sie auf wissenschaftliche Argumentation nicht von vorneherein verzichten, sich vorwiegend auf kulturanthropologische oder ethnologische Forschungen beziehen24). Capotorti distanziert sich in seiner Interpretation des Art. 27 eindeutig von allen Versuchen, einen internationalen Minderheitenschutz als Garantie kollektiver Existenz- und Entfaltungsrechte zu konstituieren; die von ihm hierfür in seiner Studie gegebene Begründung ist jedoch eher pragmatisch-politischer als analytischer Art: Erstens habe bereits das völkerbundliche Minderheitenschutzsystem nur Individualrechte garantiert, zweitens sei auch das heutige Menschenrechtssystem nur auf Individualrechte abgestimmt und drittens bestehe die Gefahr, dass ein kollektiver Minderheitenschutz sowohl in Konflikte mit den betreffenden Staaten als auch mit der individuellen Wahlfreiheit der Angehörigen einer Minderheit bei einem denkbaren Wechsel ihrer Gruppenzugehörigkeit gerate25). Dieser letzte Punkt ist entscheidend. Zugleich werden hier die Unzulänglichkeiten einer juristischen Kodifizierung des Minderheitenschutzes deutlich: Jede Gruppenbildung nach ethnischen Merkmalen tendiert dahin, die kollektive Verbindlichkeit traditionaler Lebensformen für ihre Mitglieder auch gegen die individuellen Wahlmöglichkeiten durchzusetzen, die eine funktional fragmentierte Gesellschaft modernen Typs ihren Mitgliedern (bei allen Einschränkungen) offenhält. - Dies zur Not eben auch auf der Basis einer rein intellektuellen und subkulturellen Rekonstruktion alternativer Lebensformen.
Horowitz sieht diese Tendenz sogar als wichtigste Funktion an: „… eine der wichtigsten Funktionen kultureller Bewegungen ist es, die Beibehaltung oder, zutreffender, die Rekonstruktion ethnischer Grenzziehungen zu unterstützen. ... Sie reichern Gruppenidentität mit einem neuen oder wiederbelebten kulturellen Inhalt an, der eine stärkere Bindung oder klarere Grenzziehung zwischen Gruppen bewirken kann und damit das Element individueller Identitätswahl reduziert.“26)
Hier drängt sich die Frage auf, inwieweit ein individualrechtlich orientierter Minderheitenschutz überhaupt noch in die Dynamik ethnischer Gruppenbildung eingreifen kann: konsequenter Minderheitenschutz würde erst dann wirksam, wenn er sich mit der kollektiven Abschließungstendenz dieser Form von Gruppenbildung identifizieren würde. Dies würde bedeuten, dass Minderheitenschutz in der Regel in Konkurrenz zur individualrechtlichen Orientierung des Menschenrechtsgedankens treten würde, der ja eher die Garantie einer jeder ethnischen Gruppenbildung diametral entgegenstehenden individuellen Wahlfreiheit anstreben muss - so zumindest im Verständnis von Ethnonationalisten, die Wahlfreiheit nur in der Form von „Renegatentum“ zu interpretieren pflegen. Menschenrechte sind traditionellerweise Schutzrechte gegenüber einem Kollektiv, nicht aber Existenzgarantien für ein Kollektiv gegen seine Mitglieder. Wenn ethnische Faktoren zum Thema menschenrechtlicher Schutzbemühungen werden können, dann nur insofern, als individuelle Diskriminierung aufgrund askriptiver (ethnischer, religiöser, sprachlicher) Merkmale ausgeschlossen werden muss. Am augenfälligsten sind solche Diskriminierungen in rassistischer Form oder dann, wenn Angehörige vergleichsweise traditionaler Gesellschaftssegmente in Berührung mit modernen Lebensweisen geraten: hier ist Minderheitenschutz eine Notwendigkeit. Fraglich wird die Anwendung von Kategorien des Mnderheitenschutzes dann, wenn aus „Provinz“ intellektuell und ideologisch „Ethnie“ rekonstruiert wird und damit beispielsweise Regionalismus als politische Bewegung unter den Schutz internationaler Rechtsgarantien gestellt werden soll: dies sind politische Vorgänge, deren juristische Kodifizierung entweder missbräuchlich oder illusionär erscheint. Eine Kodifizierung, die in der vorliegenden Form zudem noch am falschen Platz inkonsequent wird. Wenn man schon explizit erklärt: „Es ist sicherlich nicht die Funktion von Artikel 27, zur Bildung neuer Minderheiten anzuregen; wo eine Minderheit existiert, ist der Artikel gleichwohl auf sie anwendbar, unabhängig vom Zeitpunkt ihres Entstehens“27), dann stellt sich die Frage, warum von einem solch generalisierten Minderheitenschutz ausgerechnet jene, die mit der kulturellen, religiösen und sprachlichen Komponente ihres Andersseins sicherlich größere Probleme als viele andere moderne Minderheiten haben, ausgespart bleiben: die sog. „Gastarbeiter“28). Diese könnten als Nicht-Staatsangehörige ihrer Gastländer von einem nur auf die Staatsangehörigen beschränkten Minderheitenschutz nicht profitieren.
Fazit
Ein Minderheitenschutz, wie er exemplarisch mit Art. 27 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte angestrebt wird, Iässt sich nur schwer in ein menschenrechtlich orientiertes Schutzsystem einpassen. Seine politische Relevanz ist angesichts seiner undifferenzierten Zielrichtung als sehr gering zu veranschlagen. Die damit verbundenen politischen Zielvorstellungen sind gleichwohl ein gewichtiges Datum und zugleich vorzüglich geeignet, Reflexionen über die Prinzipien und Funktionsmuster moderner Gesellschaftsformationen in Gang zu setzen. Nicht von ungefähr wird die funktionale Universalisierung und die damit einhergehende Nivellierung oder Zerstörung der Vielfalt und ganzheitlichen Orientierung traditionaler Lebensformen in vielen Analysen als Motor regionalistischer und alternativer Protestbewegungen benannt. Auch wenn man diese Interpretation teilt: die Attraktivität alternativer Vielfalt ist ein Problem von Herrschaftsbeziehungen moderner Gesellschaften, das politisch, aber wohl kaum nach juristisch kodifizierten Grundsätzen eines internationalen Minderheitenschutzes vorliegender Art gelöst werden muss.
Anmerkungen
1) Bei seinen Vorbereitungsarbeiten für die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte behandelte der 3. Hauptausschuss der Generalversammlung das Thema Ende November 1948; ihm lagen entsprechende Anträge der Sowjetunion, Dänemarks und Jugoslawiens (UN-Doc.A/C.3/307/Rev.2 v. 20.11.1948) vor. Ablehnende Stellungnahmen kamen insbesondere von Brasilien, Frankreich und Mexiko, die u. a. mit möglichen Gefährdungen der „nationalen Einheit“ argumentierten; Großbritannien und die Vereinigten Staaten glaubten nicht an die Möglichkeit eines Kompromisses zwischen den Auffassungen der Neuen Welt, die im allgemeinen die Einwanderer assimilieren wolle, und der Alten mit ihren rassischen und nationalen Minoritäten. Großbritannien sah zudem die Rechte aller Minderheiten bereits voll durch den vorliegenden Entwurf der Menschenrechtserklärung geschützt. Auf Vorschlag des Ausschusses nahm schließlich die Generalversammlung am 10. Dezember 1948 mit 46 gegen 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen die Resolution 217(III)C an, die die Aufnahme einer gesonderten Vorschrift zur Minderheitenfrage in die Menschenrechtserklärung ablehnte und zugleich die in UN-Doc.A/C.3/307/Rev.2 enthaltenen Texte dem Wirtschafts- und Sozialrat zur Weiterleitung an Menschenrechtskommission und Unterkommission überwies; die beiden letztgenannten Gremien wurden aufgefordert, eine Studie durchzuführen, „um es den Vereinten Nationen zu ermöglichen, wirksame Maßnahmen zum Schutz rassischer, nationaler, religiöser oder sprachlicher Minderheiten zu ergreifen“.
2) Wortlaut des Artikels s. S.118/Anm.1 dieser Ausgabe.
3) Francesco Capotorti, Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, New York 1979 (UN-Publ. E.78.XIV.1), S. IV.
4) Vgl. Walker Connor, Nation-Building or Nation-Destroying? In: World Politics, Vol. XXlV, No. 3, 1972, S.319ff.
5) Wortlaut des Definitionsvorschlages s. S.118/Anm.30 dieser Ausgabe.
6) Hans Mommsen, Abschnitt A3, Spalte 637 des Stichwortbeitrags „Nationalismus, Nationalitätenfrage“. In: Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft, Bd. IV, Freiburg/Basel/Wien 1971.
7) Zum Argument einer „zumutbaren“ Mindestgröße vgl. Capotorti (Anm. 3), S. 96.
8) Donald L. Horowitz, Cultural Movements and Ethnic Change. In: The Annals, Vol. 433, September 1977, S. 7; Übersetzungen hier und in der Folge vom Verfasser.
9) Orlando Patterson, Context and Choice in Ethnic Allegiance: A Theoretical Framework and Carribean Case Study. In: Glazer/ Moynihan (Hrsg.), Ethnicity - Theory and Experience, Harvard Univ. Press 1975, S. 305.
10) Capotorti leitete die Ausarbeitung seiner Studie mit einer „provisorischen“ Definition ein; Capotorti (Anm.3), S. 7.
11) Capotorti (Anm.3), S. 8.
12) Capotorti (Anm.3), S.99.
13) Vgl. hierzu die Analysen in Bausinger/Jeggle/Korff/Scharff, Grundzüge der Volkskunde, Darmstadt 1978.
14) Vgl. zur Begründung Dirk Gerdes, Frankreich - „Vielvölkerstaat“ vor dem Zerfall? In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Bonn, Nr.12/80.
15) Art.2 Abs.1 des Paktes (davon abgeleitet u.a. Art. 4 Abs. 1, Art. 24 Abs. 1, Art. 26).
16) Hierzu verabschiedete die UN-Generalversammlung am 21. Dezember 1965 eine besondere Konvention, das „Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung“ (Text: VN 1/1968 S.28ff und BGBI 1969 II 961; zu Entstehungsgeschichte, wichtigsten materiellen Bestimmungen und Arbeitsweise der Konventionsorgane siehe den Beitrag von Karl Josef Partsch in VN 1/1971 S.1ff und 2/1971 S. 46ff). In Art. 1 Abs. 1 des Übereinkommens wird der Ausdruck „Rassendiskriminierung“ explizit auch auf Diskriminierungen bezogen, die sich aus „Abstammung“, „nationale(m) Ursprung“ oder „Volkstum“ herleiten. Besondere Schutzrechte etwa für „Volksgruppen“ werden in Art. 1 Abs. 4 nur insoweit anerkannt, als sie zur Herstellung eines Zustands der Gleichberechtigung erforderlich sind. Eine „Beibehaltung getrennter Rechte für verschiedene Rassengruppen“ wird sogar ausdrücklich abgelehnt. Ethnonationalisten zielen demgegenüber bei ihren Forderungen nach Anerkennung und Schutz ethnischer Minderheiten weniger auf Gleichberechtigung, sondern primär auf Zementierung ethnischer Gruppengrenzen - bis hin zur Diskreditierung der menschenrechtlich geschützten individuellen Wahlfreiheit beim Bekenntnis zu ethnischen und anderen Gruppen.
17) Daniel Bell, Ethnicity and Social Change, in: Glazer/Moynihan (Anm.9), S. 171.
18) Michael Hechter, The Persistence of Regionalism in the British Isles, 1885-1966. In: AJS, Vol. 79, No. 2 (1973), S. 319ff.
19) Hechter (Anm.18), S.341.
20) Mit den Ausdrücken „Regeln“ und „Regelmäßigkeiten“ übersetzt Offe das soziologische Begriffspaar „Sozial-“ und „Systemintegration“, das dem theoretischen Teil des vorliegenden Beitrags als analytisches Konzept zugrunde liegt. Vgl. Claus Offe, „Unregierbarkeit“ - Zur Renaissance konservativer Krisentheorien, in: J. Habermas (Hrsg.), Stichworte zur „Geistigen Situation der Zeit“, Bd. 1, Frankfurt a. M. 1979, S.313; weiterhin Friedrich H. Tenbruck, Die Aufgaben der Kultursoziologie. In: KZfSS, 31.Jahrg., H. 3, 1979, S. 399ff.
21) Vgl. dazu ausführlicher und mit weiteren Differenzierungen am Beispiel des schottischen und walisischen Nationalismus: Rainer-Olaf Schultze, Neo-Nationalismus in Großbritannien. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Bonn, Nr.12/80.
22) Vgl. Gerdes (Anm.14).
23) Dies scheint vor allem für den okzitanischen Regionalismus als Protestbewegung von „Raumopfern“ (Naschold) zuzutreffen.
24) Vgl. Guy Héraud, Le clivage linguistique et le fait national, in: Gras/Livet (Hrsg.), Régions et régionalisme en France, Paris 1977, S. 461ff; zur Kritik: Gerdes (Anm.14), S. 8.
25) Capotorti (Anm. 3), S. 35.
26) Horowitz (Anm. 8), S. 13.
27) wie Anm. 25.
28) Vgl. den Beitrag von Reimer Gronemeyer in diesem Heft.